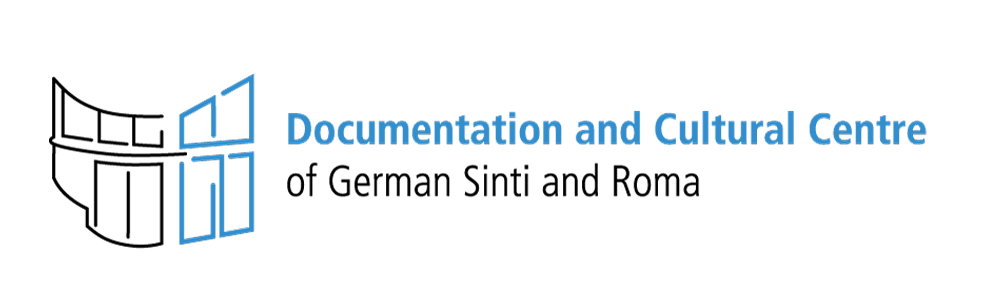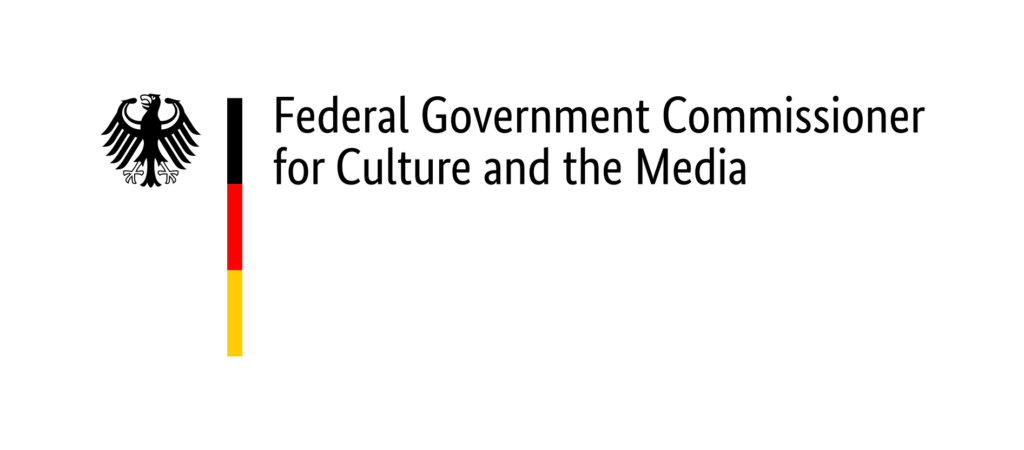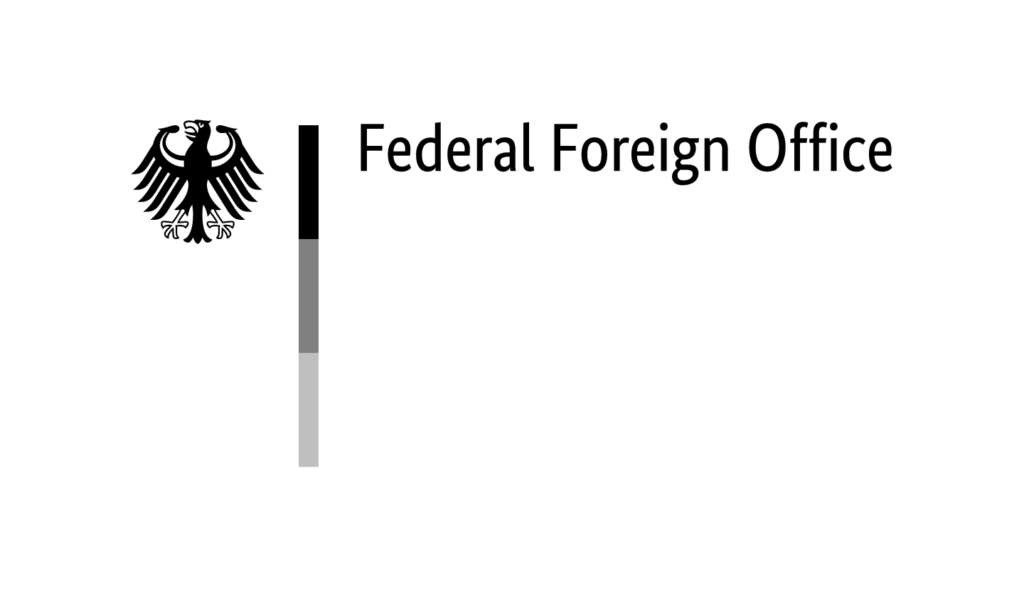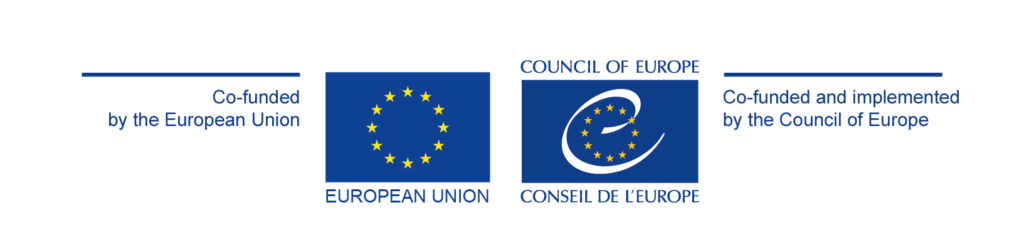2. August 2025
Romani Rose
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
Sehr geehrter Herr Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Herr Rousopoulos,
Sehr geehrter Herr Vizepräsident des Europäischen Parlaments,
Herr Hojsík,
Ich freue mich ganz besonders, Herrn Dieter Flack zu begrüßen, der heute für die Überlebenden sprechen wird, die ich alle sehr herzlich begrüßen möchte.
Sehr geehrter Herr Generalkonsul Mahnicke,
Sehr geehrte Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Alle, die wir hier sind, wissen um die Bedeutung dieses Ortes, der zum Synonym für das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte geworden ist. In Auschwitz wurden weit über eine Million Menschen ermordet: Am Schreibtisch bürokratisch geplant, in Viehwaggons effizient deportiert, in den Gaskammern erstickt, in Krematorien fabrikmäßig verbrannt. Dabei unterschieden die Nazi-Mörder nicht zwischen Juden oder Sinti und Roma. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 ermordete die SS – trotz erbitterten Widerstands – die letzten überlebenden 4.300 Sinti und Roma. Kinder, Frauen und Alte.
Eva Fahidi-Pusztai eine ungarische Jüdin war Augenzeugin dieser Vernichtungsaktion. 2019, zum 75. Jahrestag, berichtete sie uns von diesem Rednerpult aus, was sie damals sah. Vor allem, was sie hörte. Sie beschrieb, wie die Juden, starr vor Angst, im Nachbarblock des sogenannten Zigeuner-Familienlagers im Lagerabschnitt B II e, den Atem anhielten.
Sie sah die Flammenwerfer, mit denen die SS-Männer die Menschen ins Gas trieben, sah wie die Wachleute eine Mutter und ihre Tochter zu Tode peitschten, weil sie sich nicht trennen wollten. Und sie hörte die verzweifelten Schreie vor allem der Mütter, die sie ein Leben lang in sich trug.
Wörtlich sagte sie: „So unerwartet, wie diese Aktion begonnen hatte, so unerwartet ist auf einmal Ruhe eingekehrt. Und das konnte man auch kaum aushalten. Man hörte von mehreren Zehntausenden von Menschen in den verschiedenen Lagern in Auschwitz-Birkenau laut das Herz klopfen. Und so oft ich mich an diese entsetzliche Nacht erinnere, weil ich es für meine Pflicht halte, darüber zu sprechen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, wünsche ich denjenigen, die in dieser Nacht gemordet haben, dass so lange sie leben und sogar noch darüber hinaus, sie nichts im Leben hören sollen als die schrecklichen Töne dieser Nacht.“ Und sie fügte mit zarter Stimme hinzu: „Die ewige Verzweiflung soll die Täter nie verlassen.“
Am 15. April 2015, 70 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers im NS-besetzten Polen, erkannte das Europäische Parlament den Holocaust auch an unserer Minderheit an und erklärte den 2. August zum „Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma“ mit der Verpflichtung, die Menschenrechte auch dieser Minderheit in allen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft einzufordern.
Für uns ein historisches Datum.
Meine sehr geehrten Damen und Herrn, wie wichtig diese Rückbesinnung auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte ist, um daraus Lehren zu ziehen, verdeutlichen die jüngsten politischen Entwicklungen, die wir mit Angst und Sorge beobachten. Nationalistische und rechtspopulistische Bewegungen treiben die Spaltung Europas immer weiter voran. Sinti und Roma, wie auch Juden und andere Minderheiten sind heute einer neuen Dimension von Nationalismus, Rechtsextremismus und Rassismus ausgesetzt, bei der brutale Gewalt wieder zum Alltag gehört. Wir haben uns nach der Kapitulation und der Befreiung von den Nazis einen neuen Rechtsstaat gegeben, mit einer Verfassung, an deren erster Stelle die Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen steht. Und in Artikel 3 bekennt sich Deutschland zur Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Diese Werte dürfen auch in schwierigen Zeiten nicht zur Disposition gestellt werden.
Holocaust-Gedenktage kommen dabei eine wichtige Rolle zu. Vorausgesetzt sie werden nicht unter halbherzigen Lippenbekenntnissen und alljährlich wiederkehrenden leeren Ritualen erstickt. Sie müssen als das ernst genommen werden, was sie sind: Eine fortwährende Mahnung, uns für Menschenrechte und Menschenwürde einzusetzen, die nicht teilbar, nicht verhandelbar und nicht national gebunden sind.
Auschwitz ist darüber hinaus ein weltweiter Appell an die Menschlichkeit. Auschwitz lehrt uns, dass ohne Menschlichkeit jede Gemeinschaft ihre Zivilisation verliert.
Menschenrechte werden zu einem hohlen Begriff, wenn wir zulassen, dass Flüchtlinge in der Wüste verdursten oder im Meer ertrinken, wenn wir schweigend hinnehmen, dass in Gaza Kinder verhungern und man dann zynisch dies als „Kollateralschäden“ bezeichnet. Wer Unrecht akzeptiert – auch das lehrt uns Auschwitz – der macht sich mitschuldig.
Die Versuchung wegzuschauen ist groß, wenn das, was um uns herum geschieht, unerträglich ist. Doch angesichts von 500.000 ermordeten Sinti und Roma und sechs Millionen Juden sind wir verpflichtet unsere Stimmen zu erheben.
So wie es auch Else Baker seit Jahrzehnten tut. Als junges Mädchen wurde sie aus ihrer Pflegefamilie heraus nach Auschwitz verschleppt, weil ihre Mutter von den Nazis als „Zigeunerin“ verfolgt wurde. An der Seite von Eva Fahidi-Pusztai sagte sie zum 75. Jahrestag: „Wir alle – die Überlebenden der Vernichtungslager genau wie die Nachgeborenen – müssen für Menschenrechte und Demokratie eintreten. Wir dürfen uns nie sicher sein, dass sich die Verbrechen der Nazis nicht wiederholen.“
Eine ernst zu nehmende Warnung.
Noch leben wir in der Gewissheit der Einmaligkeit der ungeheuerlichen Nazi-Verbrechen. Denn die industrielle, bürokratische, kaltblütige millionenfache Ermordung von Menschen, die nicht in das Weltbild einer rassistischen Willkürherrschaft passten, hatte in der Menschheitsgeschichte keine Vorgänger und bislang keine Nachahmer. Jeder Vergleich mit anderen Taten und seien sie noch so schrecklich, ist unzulässig, weil er das Ungeheuerliche, das Monströse des Holocaust, relativieren würde.
Auschwitz ist auch deshalb so schwer erträglich, weil hier das ganze Ausmaß einer unvorstellbaren Entmenschlichung offenbar wird, weil wir uns hier mit all der Grausamkeit und Bösartigkeit auseinandersetzen müssen, wozu der Mensch fähig ist. Auschwitz wirft den Menschen schutzlos auf sein Sein zurück.
All die Überlebenden, die Auschwitz durchlitten haben, eint ihr Flehen nach Menschlichkeit. Sie werden als Mahner nicht mehr lange unter uns sein, aber sie haben ihre Erfahrung an uns weitergegeben, damit sich die Nachgeborenen mit Menschlichkeit gegen den größten Zivilisationsbruch der Menschheit stemmen. Das ist unsere Verpflichtung aus Auschwitz.
Fritz Bauer, der als Vertreter der Anklage in den Auschwitz-Prozessen Anfang der 60er Jahre, mit den Lügen, den Verächtlichmachungen der Opfer und den billigen Entschuldigungen der Täter konfrontiert wurde, stellte am Ende resigniert fest: „Ich glaube, es ist eine traurige Wahrheit, dass die Zivilisation nur eine sehr dünne Decke ist, die sehr schnell abblättert.“
Primo Levi schildert als Überlebender des Holocaust in seinem autobiografischen Werk „Ist das ein Mensch“? einen alles verschlingenden Abgrund, aus dem er nur wieder auftauchen konnte, weil er in dieser Hölle auf einen wahren Menschen traf. Über den Mann, der ihm zum Freund wurde, schreibt er: „Seine Menschlichkeit – nicht korrumpiert und nicht verroht, fern von Hass und Angst… eine entfernte Möglichkeit des Guten, für die es sich immerhin lohnt, sein Leben zu bewahren.“ Aber er warnte auch: „Auschwitz ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen“.
Die zehn Frauen und Männer, die im Januar 2009 in Berlin als Vertreter der Internationalen Häftlingskomitees der Konzentrationslager das „Vermächtnis der Überlebenden“ formulierten, in dem sie sich für eine gerechte, friedliche und tolerante Welt einsetzen, zweifeln daran, dass die Menschheit aus der Geschichte etwas gelernt hat.
Ich neige dazu ihnen Recht zu geben. Der augenblickliche Zustand auf unserem Erdball lässt keinen anderen Schluss zu.
Bundespräsident Roman Herzog sagte am 19. Januar 1996 zum ersten „Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus“ im Deutschen Bundestag: „Die entscheidende Aufgabe ist es heute, eine Wiederholung – wo und in welcher Form auch immer – zu verhindern. Dazu gehört beides: die Kenntnis der Folgen von Rassismus und einer totalitären Staatsform und die Kenntnis der Anfänge, die oft im Kleinen, ja sogar im Banalen liegen können“.
Deutschland hat seine Hausaufgaben in dieser Hinsicht in den Nachkriegsjahren nur unvollständig gemacht. Das liegt vor allem daran, dass die deutschen Behörden – von wenigen Ausnahmen abgesehen – sich weigerten, ihre Beteiligung am Unrechtsstaat der Nazis aufzuarbeiten. So konnten die Täter von einst ihre NS-Ideologie vor allem gegen Sinti und Roma in die Nachkriegsbürokratie implantieren. Hier standen sie nicht, wie im Fall der jüdischen Minderheit, unter Beobachtung der Weltöffentlichkeit. Aus diesem behördlichen Antiziganismus und seine entsprechende Verbreitung über die meisten Medien erwächst die breite Ablehnung der Bevölkerung gegenüber unserer Minderheit. Bis heute halten Diskriminierung, Ausgrenzung und Sondererfassungen an. Tendenz steigend.
Bis heute ist der Bevölkerung unseres Landes immer noch nicht bewusst, dass Holocaust auch die Vernichtung von 500.000 europäischen Sinti und Roma bedeutet. Wir konnten es nicht durchsetzen, dass dies ins kollektive Bewusstsein dieser Nation aufgenommen wird.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 24. Oktober 2022, 40 Jahre nach der Anerkennung des Völkermords durch Helmut Schmidt, in seiner beachtenswerten Rede am Denkmal für die
ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin mit klaren Worten das fortgesetzte Unrecht nach 1945 benannt. Ich zitiere:
„Behörden, Polizei und Justiz diskriminierten, stigmatisierten oder kriminalisierten Angehörige der Minderheit; in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit wurde der Völkermord an den Sinti und Roma verschwiegen, verleugnet oder verdrängt; Ansprüche auf Entschädigung wurden lange, viel zu lange nicht anerkannt. Auch für dieses zweite Leid, das den Sinti und Roma in der Nachkriegszeit angetan wurde, will ich heute im Namen unseres Landes um Vergebung bitten.
Vor zwei Jahren appellierte ich von dieser Stelle aus an alle deutschen Innenminister, die Unrechtsgeschichte der Polizei im NS-Staat gegenüber unserer Minderheit wissenschaftlich aufzuarbeiten, wie es das Bundeskriminalamt vorbildlich getan hat. Ich forderte die Sicherheitsbehörden auf, die fortgesetzte antiziganistische Sondererfassung und Kriminalisierung von Sinti und Roma durch die Polizei auf Grundlage der Abstammung endlich zu beenden. Passiert ist – nichts.
Die Kritik an dieser menschenverachtenden Praxis, die ihr Vorbild bei den Nationalsozialisten findet, vom Kommissar für Menschenrechte im Europarat und auch von „Amnesty International“ verurteilt, prallt an einer ignoranten Politik ab und offenbart, wie tief der institutionelle Antiziganismus immer noch vorherrscht.
Von unserem demokratischen Rechtsstaat werden wir vor der Weltöffentlichkeit ohne jegliche Scham als anerkannte nationale Minderheit im Stich gelassen. Angesichts der Vernichtungsmaschinerie von Auschwitz und im Wissen, was Sinti und Roma unter dem Unrechtsregime der Nazis erleiden mussten, erwarte ich von der deutschen Politik, die dem Grundgesetz verpflichtet ist, endlich ihr gesetzeswidriges Verhalten gegenüber unserer Minderheit zu beenden.
Der Rassismus der Nazis führte in die Entmenschlichung der Vernichtungslager. Der Rassismus unserer Tage, dazu gehören Antiziganismus und Antisemitismus, führt zur Zerstörung unserer demokratischen Gesellschaft. Diesen Sieg dürfen wir den Rechtsextremen nicht überlassen. Dagegen müssen wir eine Menschlichkeit setzen, die ihre Kraft aus diesem Ort des unaussprechlichen Grauens und der absoluten Hoffnungslosigkeit zieht. Auschwitz darf seine moralische Kraft niemals verlieren!